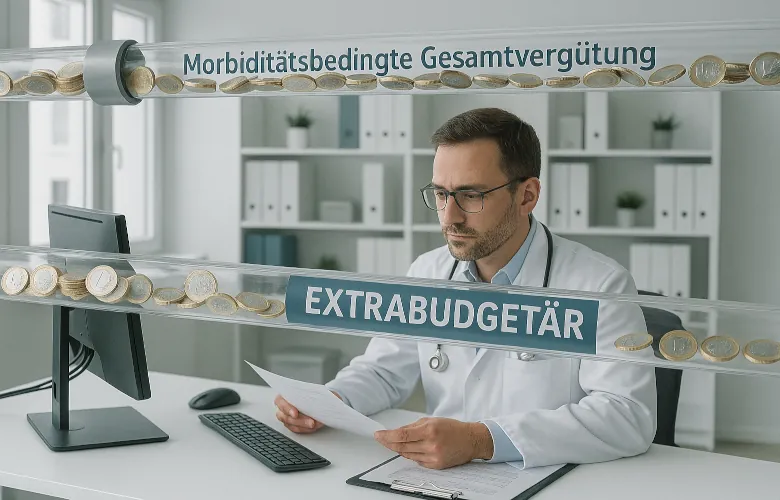Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Das Wichtigste auf einen Blick
- Extrabudgetäre Gesamtvergütung bezeichnet ärztliche Leistungen, die außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung zum vollen EBM‑Wert und ohne mengenmäßige Begrenzung vergütet werden.
- Der Anteil extrabudgetärer Leistungen an der vertragsärztlichen Gesamtvergütung stieg von 22 % (2009) auf rund 43 % (2022), was die Finanzstabilität der gesetzlichen Krankenversicherung belastet und die Ausgabensteuerung erschwert.
- Kritikpunkte sind fehlende systematische Evaluationen vieler EGV‑Leistungen, Doppelfinanzierungen durch das TSVG mit über einer Milliarde Euro Mehrausgaben und die Forderung, EGV auf nachweislich nützliche Bereiche zu beschränken.
Inhaltsverzeichnis
Was ist die extrabudgetäre Gesamtvergütung?
Die extrabudgetäre Gesamtvergütung bezeichnet alle ärztlichen Leistungen, die außerhalb des gedeckelten Budgets der Kassenärztlichen Vereinigungen vergütet werden. Sie wird separat von der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung finanziert und ist nicht an die regionale Budgetverteilung gebunden. Das bedeutet: Diese Leistungen werden zum vollen EBM-Wert vergütet – ohne mengenbedingte Kürzungen.
Typische Merkmale:
- Keine mengenmäßige Begrenzung durch die KV
- Vergütung erfolgt unabhängig von der Morbiditätsstruktur der Versicherten
- Abrechnung über den EBM, jedoch mit fester Preisstruktur
Die Gesamtvergütung besteht aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) und der extrabudgetären Gesamtvergütung (EGV). Die MGV finanziert die Grundversorgung und basiert auf der Morbidität der Versicherten (Anteil ca. 70 %). Sie ist budgetiert und verteilt mengenabhängig, was bei hohem Leistungsvolumen zu Abschlägen führt. Die EGV honoriert definierte Leistungen ohne Mengenbegrenzung, etwa Prävention oder Sonderverträge. Beide Vergütungen steuern gemeinsam eine bedarfsgerechte und qualitative Versorgung.
Welche Leistungen zählen zu den extrabudgetären Leistungen?
Nicht alle vertragsärztlichen Leistungen unterliegen der Budgetierung. Zu den extrabudgetären Leistungen zählen unter anderem:
- Früherkennungsuntersuchungen (z. B. Krebsvorsorge und andere gesetzlich geregelte Vorsorgeuntersuchungen)
- Impfleistungen
- Leistungen von Honorarärzten im Notdienst
- Sozialpsychiatrische Leistungen (unter bestimmten Voraussetzungen)
- Ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV)
- Einige Leistungen im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge
Warum gibt es extrabudgetäre Leistungen?
Die extrabudgetäre Vergütung wurde eingeführt, um bestimmte medizinische Leistungen gezielt zu fördern und flächendeckend verfügbar zu machen – unabhängig von Budgetrestriktionen. Hintergrund ist der politische Wille, zentrale Versorgungsbereiche wie Prävention, Impfungen oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst finanziell abzusichern.
Ziele der extrabudgetären Abrechnung:
- Anreize für präventive Maßnahmen schaffen
- Versorgungsgerechtigkeit erhöhen
- Versorgungsengpässe, etwa im Notdienst, ausgleichen
- Bürokratische Steuerung über mengenbegrenzende Maßnahmen reduzieren
Kritik an der extrabudgetären Vergütung
Der Bericht des Bundesrechnungshofes stellt der extrabudgetären Vergütung ein kritischeres Zeugnis aus, als es die einführende Beschreibung nahelegt. Während die extrabudgetäre Finanzierung ursprünglich dazu diente, gezielt bestimmte Leistungen zu fördern, zeigt sich zunehmend, dass deren Umfang und finanzielle Auswirkungen kaum kontrolliert werden. Wesentliche Kritikpunkte sind:
- Starker Anstieg der Ausgaben: Der Anteil extrabudgetärer Leistungen an der vertragsärztlichen Gesamtvergütung hat sich zwischen 2009 und 2022 fast verdoppelt – von 22 % auf rund 43 %. Diese Entwicklung belastet die Finanzstabilität der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erheblich.
- Fehlende Ausgabensteuerung: Im Gegensatz zur morbiditätsbedingten Gesamtvergütung unterliegt die extrabudgetäre Vergütung keiner Mengenbegrenzung. Dies erhöht die Gefahr wirtschaftlich nicht gerechtfertigter Leistungen und einer angebotsinduzierten Nachfrage.
- Unzureichende Evaluation: Viele extrabudgetär vergütete Leistungen bestehen seit Jahren, ohne dass ihre Notwendigkeit oder Wirksamkeit systematisch überprüft wird. Evaluierungen fehlen oftmals oder bleiben oberflächlich. Eine klare Strategie zur Überführung bewährter Leistungen in die MGV („Eindeckelung“) existiert nicht.
- Kritik an TSVG-Leistungen: Die mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführten Vergütungsanreize – wie Zuschläge bei Terminvermittlung, offenen Sprechstunden oder für Neupatienten – führten teilweise zu Doppelfinanzierungen und erhöhten die Ausgaben um über eine Milliarde Euro. Der Nutzen dieser Maßnahmen, etwa zur Verkürzung von Wartezeiten, ist nicht belegt. Der Bundesrechnungshof empfiehlt, die verbliebenen TSVG-Vergütungsregelungen vollständig zu streichen.
- Politisch motivierte Entbudgetierung: Die geplante Aufhebung der Budgetierung hausärztlicher Leistungen (tritt voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2025 in Kraft) wird ebenfalls kritisch bewertet. Eine pauschale Entbudgetierung sei weder zielgerichtet noch wirtschaftlich begründbar. Der Bundesrechnungshof fordert, solche Maßnahmen auf unterversorgte Regionen zu beschränken und systematisch zu evaluieren.
- Verlust an Steuerungsfähigkeit: Die zunehmende Ausweitung extrabudgetärer Leistungen untergräbt zentrale Prinzipien der GKV – insbesondere die Beitragssatzstabilität und die bedarfsgerechte Ausgabensteuerung. Der Bundesrechnungshof warnt vor einer Aushöhlung der MGV als Regelsystem ärztlicher Vergütung.
Insgesamt wird gefordert, extrabudgetäre Leistungen auf solche Bereiche zu beschränken, in denen deren Nutzen für Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung nachweislich gegeben ist. Andernfalls drohen Fehlsteuerungen, finanzielle Mehrbelastungen und eine Entkopplung medizinischer Leistungen von objektivem Behandlungsbedarf.