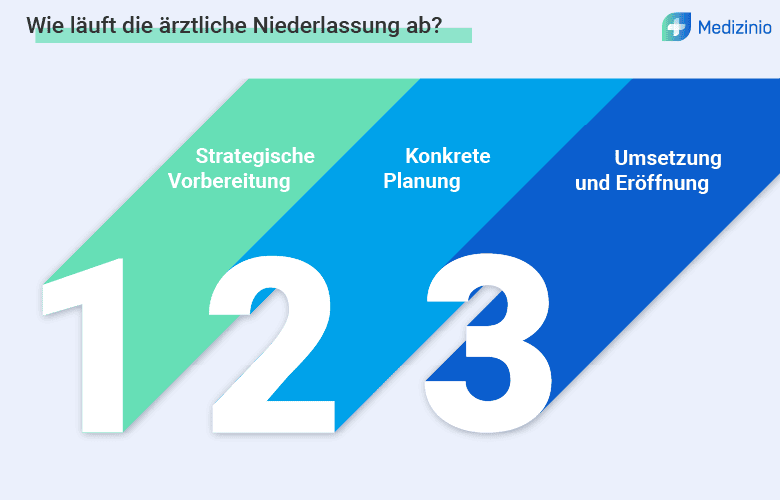Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Das Wichtigste auf einen Blick
- Für vertragsärztliche Tätigkeit sind Approbation, Eintrag ins Arztregister bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung, ein anerkannter Facharzttitel sowie die Zulassung durch den Zulassungsausschuss der KV erforderlich; für eine rein private Praxis reicht die Approbation.
- Praxisübernahme bietet vorhandene Räume, Geräte und einen etablierten Patientenstamm sowie bessere Planbarkeit von Umsatz und Finanzierung, birgt aber das Risiko, Altlasten und eingeschränkte Gestaltungsfreiheit zu übernehmen; Neugründung ermöglicht maximale Gestaltungsfreiheit, erfordert jedoch höheren Planungs‑ und Finanzierungsaufwand sowie längere Zeit zum Aufbau eines Patientenstamms.
- Die Niederlassung verläuft typischerweise in drei Phasen — strategische Vorbereitung (ca. 6–12 Monate), konkrete Planung (ca. 3–9 Monate) und Umsetzung/Eröffnung (ca. 1–3 Monate) — und umfasst Standortwahl, Finanzierungs‑ und Zulassungsanträge, Ausstattung sowie Personalplanung.
Inhaltsverzeichnis
Praxisübernahme oder Neugründung – eine Entscheidung mit Tragweite
Die Entscheidung, sich als Arzt, Zahnarzt oder Psychotherapeut niederzulassen, markiert einen bedeutenden Wendepunkt im beruflichen Werdegang. Wer diesen Schritt geht, steht vor der grundlegenden Frage: Praxisübernahme oder Neugründung? Beide Optionen bieten attraktive Chancen, stellen aber auch unterschiedliche Anforderungen und Risiken dar. Eine fundierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen ist unerlässlich für zukünftige Praxisinhaber, um eine tragfähige und zukunftssichere Entscheidung zu treffen.
| Kriterium | Praxisübernahme | Praxisneugründung |
| Infrastruktur | Bestehende Räume, Geräte und IT-Systeme sind vorhanden | Vollständige Gestaltung nach eigenen Vorstellungen erforderlich |
| Patientenstamm | Übernahme des etablierten Patientenstamms | Patientenstamm muss eigenständig aufgebaut werden |
| Personal | Eingespieltes Team kann übernommen werden | Personal muss neu rekrutiert und eingearbeitet werden |
| Finanzierung | Gute Planbarkeit durch bekannte Umsatz- und Kostenzahlen | Höherer Planungsaufwand und anfängliche Unsicherheit bei Umsatzentwicklung |
| Gestaltungsfreiheit | Eingeschränkt durch bestehende Strukturen | Maximale Freiheit bei Raumkonzept, Leistungsspektrum und Positionierung |
| Zeitlicher Aufwand | Schnellere Aufnahme der Tätigkeit möglich | Längere Vorbereitungszeit bis zur Eröffnung |
| Risiken | Übernahme von Altlasten (z. B. veraltete Technik, schlechte Lage) möglich | Wirtschaftliches Risiko durch Nullstart und Investitionshöhe |
| Standort | Standort ist vorgegeben | Freie Wahl des Standorts, aber mit höherem Recherche- und Genehmigungsaufwand |
Praxisübernahme: Bewährte Strukturen nutzen
Die Übernahme einer bestehenden Praxis gilt für viele Ärzte als naheliegender Einstieg in die Selbstständigkeit. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der vorhandenen Infrastruktur: Räume, Geräte, Software und gegebenenfalls auch Personal sind bereits vorhanden. Zudem profitieren Übernehmende von einem etablierten Patientenstamm und gewachsenen Abläufen, was den Einstieg deutlich erleichtern kann.
Ein weiterer Pluspunkt: Der wirtschaftliche Wert der Praxis lässt sich im Rahmen der anhand von Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Patientenfrequenz relativ gut abschätzen. Dies ermöglicht eine realistische Planung, was insbesondere für die investitionsintensive Finanzierung einer Zahnarztpraxis von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig sollte eine sorgfältige Prüfung der Praxisdaten, Verträge und Standortbedingungen erfolgen – idealerweise mit professioneller Unterstützung durch eine spezialisierte Niederlassungsberatung.
Nachteilig kann sein, dass Altlasten übernommen werden, etwa in Form veralteter Ausstattung, ineffizienter Prozesse oder eines ungünstigen Images. Auch der Anpassungsbedarf an die eigene medizinische Ausrichtung kann hoch sein, wenn beispielsweise das Leistungsspektrum stark von den eigenen Plänen abweicht.
Neugründung: Die eigene Vision verwirklichen
Die Arztpraxis-Neueröffnung bzw. Zahnarztpraxis-Neugründung bietet maximale Gestaltungsfreiheit. Räumlichkeiten, Ausstattung, Team und medizinisches Angebot lassen sich von Beginn an individuell planen. Für Ärztinnen und Ärzte mit einer klaren Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft kann dies ein entscheidender Vorteil sein.
Allerdings geht eine Neugründung mit höherem Planungs- und Finanzierungsaufwand einher. Der Aufbau eines Patientenstamms, der Aufbau von Prozessen und die Entwicklung eines tragfähigen Praxiskonzepts erfordern Zeit, unternehmerisches Denken und oft auch einen längeren Atem bis zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit.
Voraussetzungen für eine Niederlassung als Arzt
Wer als Arzt oder Ärztin den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, betritt nicht nur fachlich, sondern auch organisatorisch neues Terrain.
Grundlage jeder ärztlichen Tätigkeit in eigener Praxis ist die Approbation. Sie berechtigt zur Ausübung des Berufs, ist jedoch noch nicht gleichbedeutend mit der Niederlassungsberechtigung. Wer als Vertragsarzt tätig werden möchte – also gesetzlich Versicherte behandeln will – benötigt darüber hinaus:
- Den Eintrag ins Arztregister bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
- Einen anerkannten Facharzttitel
- Die Zulassung durch den Zulassungsausschuss der KV (Kassenzulassung)
Wer eine Privatpraxis gründen möchte, unterliegt weniger strengen Vorgaben als Vertragsärzte. Da gesetzlich Versicherte hier nicht behandelt werden, ist keine Kassenzulassung erforderlich – auch der Eintrag ins Arztregister entfällt. Die Approbation bleibt jedoch Voraussetzung. Gerade für Fachärzte mit klar umrissener Zielgruppe kann die private Niederlassung eine attraktive Alternative sein.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist die regionale Bedarfsplanung. Diese legt fest, ob ein Planungsbereich für bestimmte Fachgruppen offen oder gesperrt ist. In einem offenen Planungsbereich ist die Niederlassung in der Regel ohne lange Wartezeit möglich. In einem gesperrten Bereich ist die Zahl der Vertragsarztsitze bereits ausgeschöpft – eine Niederlassung ist dort nur möglich, wenn ein bestehender Sitz übernommen wird oder ein Platz über die Warteliste frei wird. Eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen KV ist daher wichtig.
Neben den formalen und fachlichen Anforderungen spielen auch persönliche Voraussetzungen eine entscheidende Rolle für eine erfolgreiche Niederlassung. Selbstständiges Arbeiten, unternehmerisches Denken und Führungsstärke sind ebenso gefragt wie Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit und ein gewisses Organisationstalent. Bei der Praxisführung übernimmt man nicht nur medizinische Verantwortung, sondern ist auch Arbeitgeber, Entscheider und oft erste Ansprechperson für Patienten und Mitarbeitende. Eine realistische Selbsteinschätzung und ggf. ergänzende betriebswirtschaftliche Weiterbildung sind daher empfehlenswert.
Wie läuft die Niederlassung ab?
Phase 1: Strategische Vorbereitung (etwa 6–12 Monate vor Eröffnung)
In der ersten Phase erfolgt die grundlegende Ausrichtung der künftigen Arztpraxis. Neben konzeptionellen Überlegungen stehen erste rechtliche und wirtschaftliche Weichenstellungen im Vordergrund:
- Zielsetzung: Definition der fachlichen Ausrichtung, Praxisgröße und angestrebten Patientenstruktur
- Förderprogramme prüfen: Identifikation regionaler oder bundesweiter Fördermittel für die Arztpraxis
- Standortwahl und Bedarfsplanung:
- Analyse der Versorgungslage
- Prüfung, ob der Standort in einem offenen oder gesperrten Planungsbereich liegt
- Ermittlung der Möglichkeiten einer Neuniederlassung oder Praxisübernahme
- Gegebenenfalls Eintragung in die Warteliste der KV bei Zulassungsbeschränkungen
- Eintragung ins Arztregister: Antragstellung bei der zuständigen KV auf Basis des Wohnortprinzips
- Zulassungsantrag vorbereiten:
- Antragstellung auf vertragsärztliche Zulassung beim Zulassungsausschuss der KV
- Entscheidung über Art der Zulassung (volle oder halbe Zulassung/Teilzulassung) und deren Auswirkungen auf den Versorgungsauftrag
- Raumsuche und Standortprüfung:
- Auswahl eines geeigneten Praxisstandorts unter Berücksichtigung baulicher Anforderungen (z. B. Barrierefreiheit, Raumaufteilung, technische Infrastruktur) sowie rechtlicher Rahmenbedingungen (z. B. Nutzungsrecht, Bauordnung). Zusätzlich sollten wirtschaftliche Faktoren wie Erreichbarkeit, Wettbewerbssituation und Entwicklungspotenzial geprüft werden.
- Praxisbörsen und Niederlassungsberater bieten einen Überblick über zur Übernahme stehende Praxen.
- Finanzielle Erstplanung: Grobe Kalkulation von Investitions- und Betriebskosten
- Entwicklung des Praxiskonzepts: Erste Entwürfe für Businessplan, Leistungsangebot und organisatorische Abläufe
- Niederlassungsform prüfen: Auswahl zwischen Einzelpraxis, Berufsausübungsgemeinschaft, Teilzulassung, Job-Sharing usw.
- Rechtsform prüfen: Wahl der passenden Rechtsform – z. B. Einzelunternehmen, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Partnerschaftsgesellschaft (PartG) oder GmbH.
Phase 2: Konkrete Planung (etwa 3–9 Monate vor Eröffnung)
Die Idee wird jetzt rechtlich abgesichert und finanziell fundiert umgesetzt. In dieser Phase werden zentrale Anträge gestellt und die Grundlage für den Betrieb geschaffen:
- Vertragliche Grundlagen schaffen: Mietverträge, Kooperationsvereinbarungen, ggf. Arbeitsverträge vorbereiten
- Finanzierung sichern: Bankgespräche führen, Fördermittel beantragen, Darlehen abschließen
- Absicherung klären: Abschluss relevanter Versicherungen, insbesondere der Berufshaftpflicht
- Genehmigungen beantragen: Je nach Fachgebiet und Ausstattung (z. B. für Röntgen- oder Ultraschallgeräte) sind zusätzliche Genehmigungen notwendig
- Kommunikation, Werbung & Außenauftritt planen: Entwicklung von Praxisname, Logo, Website und ersten Marketingmaßnahmen. Erfahren Sie hier alles über das Thema Praxismarketing.
- Versorgungsauftrag beachten: Vertragsärzte sind zur Erfüllung eines Mindeststundenkontingents in der Patientenversorgung verpflichtet (25 Std./Woche in Form von Sprechstunden bei voller Zulassung).
Phase 3: Umsetzung und Eröffnung (etwa 1–3 Monate vor dem Start)
- Praxis ausstatten: Einrichtung mit Medizingeräten, PVS-System, Praxiseinrichtung
- Mitarbeiter einstellen bei Praxisneugründung:
- Verträge erstellen
- Sozialversicherungspflicht prüfen
- Anmeldung bei gesetzlicher Krankenversicherung
- Buchhaltung und Abrechnung:
- Praxissoftware mit Buchhaltung einrichten
- Zusammenarbeit mit Steuerberatung klären
- Letzte rechtliche Schritte:
- Ärztekammer: Meldung mit Praxisadresse, Eröffnungsdatum, Approbation, Zulassung und Sprechzeiten
- Gesundheitsamt: Information über Praxisaufnahme
- Versorgungswerk: Anmeldung zur ärztlichen Altersversorgung (inkl. Befreiung von der Deutschen Rentenversicherung)
- Finanzamt: Anzeige der freiberuflichen Tätigkeit innerhalb eines Monats nach Aufnahme
- Weitere Meldepflichten:
- Anmeldung medizinischer Geräte beim TÜV
- Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Geräteprüfung
Allein oder im Team? Praxisformen für die ärztliche Selbstständigkeit
Die Wahl der richtigen Praxisform ist eine zentrale Entscheidung auf dem Weg in die ärztliche Selbstständigkeit. Sie beeinflusst nicht nur den Arbeitsalltag, sondern auch wirtschaftliche Aspekte, Verantwortlichkeiten und die persönliche Zufriedenheit. Ob allein oder in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen – jede Praxisform bietet eigene Chancen und Herausforderungen. Wer sich mit der Niederlassung befasst, muss die verschiedenen Modelle kennen.
Einzelpraxis
Die Einzelpraxis ist die klassische Form der ärztlichen Selbstständigkeit. Sie bietet volle Entscheidungsfreiheit, eine klare Patientenbindung und eine hohe Unabhängigkeit in der Organisation und medizinischen Ausrichtung.
- Vorteile
- Eigenverantwortliche Gestaltung der Praxis
- Persönliche Beziehung zu den Patienten
- Klare Zuständigkeiten und Entscheidungswege
- Nachteile
- Volle unternehmerische Verantwortung
- Hohe Arbeitsbelastung, insbesondere bei Ausfällen
- Begrenzte Möglichkeiten der Spezialisierung und interdisziplinären Zusammenarbeit
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)
In einer Berufsausübungsgemeinschaft – häufig auch als Gemeinschaftspraxis bezeichnet – führen zwei oder mehr Ärzte eine gemeinsame Praxis mit gemeinsamer Patientenversorgung und einheitlicher Abrechnung.
- Vorteile
- Gemeinsame Verantwortung und geteilte Kosten
- Möglichkeit der Arbeitsteilung und fachlichen Spezialisierung
- Bessere Work-Life-Balance durch Vertretungsmöglichkeiten
- Nachteile:
- Notwendigkeit klarer Absprachen und geregelter Zusammenarbeit
- Risiko von Konflikten bei unterschiedlichen Vorstellungen
- Komplexere rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen
Praxisgemeinschaft
Bei einer Praxisgemeinschaft teilen sich mehrere Ärzte lediglich die Infrastruktur, jedoch nicht die Patientenversorgung. Jeder Arzt führt seine eigene Praxis mit separater Abrechnung.
- Vorteile
- Kosteneinsparungen durch gemeinsame Nutzung von Räumen und Geräten
- Erhalt der eigenen Unabhängigkeit in der Patientenversorgung
- Flexibles Kooperationsmodell mit geringem rechtlichen Risiko
- Nachteile
- Keine Vertretungsmöglichkeiten
- Weniger Synergieeffekte in der medizinischen Arbeit
- Gefahr der Verwechslung durch Patienten (gemeinsames Praxis-Erscheinungsbild)
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ)
Das MVZ ist eine fachübergreifende oder arztgruppengleiche Einrichtung. Träger können ärztliche Kollegen, Krankenhäuser oder andere juristische Personen sein.
- Vorteile
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
- Entlastung durch organisatorische Strukturen
- Attraktiv für angestellte Ärzte mit geregelten Arbeitszeiten
- Nachteile
- Eingeschränkte Selbstständigkeit für angestellte Ärzte
- Stärkere betriebswirtschaftliche Ausrichtung
- Geringere Einflussnahme auf strategische Entscheidungen bei fremden Trägern
Form folgt Funktion: Wie die Rechtsform Ihre Praxis beeinflusst
Die Wahl der richtigen Rechtsform ist ein zentraler Schritt bei der Niederlassung – sie bildet das juristische Fundament Ihrer Selbstständigkeit. Ob Sie allein oder im Team praktizieren: Die Rechtsform bestimmt Ihre persönliche Haftung, die steuerliche Behandlung, Ihre Finanzierungsmöglichkeiten und die organisatorische Struktur Ihrer Praxis. Wer von Anfang an die passende Form wählt, kann Risiken minimieren, steuerliche Vorteile nutzen und strategisch wachsen.
Einzelunternehmen
Das Einzelunternehmen ist die klassische Rechtsform für Einzelpraxen. Es eignet sich für Ärztinnen und Ärzte, die unabhängig arbeiten möchten und keine Gesellschaftsstruktur benötigen.
- Vorteile
- Schnelle, unkomplizierte Gründung ohne Mindestkapital
- Volle Entscheidungsfreiheit
- Geringe laufende Verwaltungskosten
- Nachteile
- Unbeschränkte Haftung mit dem Privatvermögen
- Keine Risikoteilung oder Arbeitsteilung möglich
- Begrenzte Expansionsmöglichkeiten
- Geeignet für: Ärztinnen und Ärzte mit überschaubarem Investitionsbedarf, die eine Einzelpraxis führen möchten.
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Die GbR ist die häufigste Form für Gemeinschaftspraxen. Zwei oder mehr Partner schließen sich zusammen – meist mit einem einfachen Gesellschaftsvertrag.
- Vorteile
- Geringe Gründungshürden, kein Mindestkapital
- Hohe Flexibilität in der Gestaltung der Zusammenarbeit
- Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ausreichend
- Nachteile
- Persönliche, gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter
- Konfliktpotenzial bei unklaren Regelungen
- Bei Ausscheiden eines Gesellschafters rechtliche Unsicherheiten
- Geeignet für: Kolleginnen und Kollegen mit vertrauensvoller Zusammenarbeit, die gemeinsam eine Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) oder Praxisgemeinschaft gründen möchten.
Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
Die PartG kombiniert flexible Zusammenarbeit mit klarer Haftungsstruktur – und ist bei Ärzten mit wachsendem Anspruch an Professionalität beliebt.
- Vorteile
- Haftung nur durch den verantwortlichen Partner bei Behandlungsfehlern
- Professioneller Außenauftritt (Eintrag ins Partnerschaftsregister)
- Geringere Steuerlast als bei Kapitalgesellschaften
- Nachteile
- Persönliche Haftung für wirtschaftliche Verbindlichkeiten
- Aufwendigerer Gesellschaftsvertrag nötig
- Eingeschränkte Skalierbarkeit bei Investitionen
- Geeignet für: Ärzteteams, die eine fachlich differenzierte Zusammenarbeit anstreben – z. B. interdisziplinäre Berufsausübungsgemeinschaften.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Die GmbH eignet sich für größere Praxisstrukturen oder medizinische Versorgungszentren (MVZ). Sie schafft klare Regeln, schützt Privatvermögen und ist insbesondere bei wachstumsorientierten Vorhaben geeignet.
- Vorteile
- Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen
- Professionelles Auftreten, höhere Kreditwürdigkeit
- Geeignet für Anstellung von Ärzten, Beteiligung von Investoren
- Nachteile
- Gründung erfordert notariellen Vertrag und 25.000 € Stammkapital
- Bilanzierungspflicht und erhöhter Verwaltungsaufwand
- Doppelbesteuerung bei Gewinnausschüttung
- Geeignet für: Ärztinnen und Ärzte mit großem Investitionsbedarf, Expansionsplänen oder Ambitionen zur Führung eines MVZ.
Wichtige Fragen auf dem Weg zur eigenen Praxis: Was ein Niederlassungsberater mit Ihnen klärt
Ein Niederlassungsberater begleitet Sie systematisch durch alle Phasen der Praxisgründung oder -übernahme und hilft, typische Fragestellungen fundiert zu klären. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche und rechtliche Aspekte, sondern auch um Ihre persönlichen Zielsetzungen und das passende Praxismodell.
Konkrete Fragen, die in der Beratung gemeinsam besprochen werden, sind unter anderem:
- Bestandsaufnahme bei Praxisübernahme:
- Was genau kaufe ich?
- Wie steht die Praxis wirtschaftlich da?
- Wie haben sich Umsätze, Fallzahlen und Gewinne in den letzten Jahren entwickelt?
- Gibt es erkennbare Trends oder saisonale Schwankungen?
- Haben außerordentliche Aufwendungen oder Einmalerlöse den Gewinn beeinflusst?
- Praxisstrategie und Standortwahl:
- Ist der Standort zukunftsfähig und passend für mein Fachgebiet?
- Gibt es Konkurrenz oder Kooperationspotenzial im Umfeld?
- Finanzierung und Investitionen:
- Wie hoch ist der Investitionsbedarf?
- In welchem Verhältnis sollten Eigen- und Fremdkapital eingesetzt werden? Ist eine Praxisfinanzierung ohne Eigenkapital möglich?
- Welche Finanzierungsmodelle und Fördermittel stehen zur Verfügung?
- Welche Rückzahlungszeiträume sind realistisch?
- Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen:
- Welche Gesellschaftsform ist für meine Praxis sinnvoll?
- Was muss im Praxisübernahmevertrag geregelt werden?
- Wie sieht eine sinnvolle Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten aus?
- Organisation, Abrechnung und Praxispersonal:
- Wie funktioniert die EBM- und GOÄ-Abrechnung?
- Welche Abläufe müssen im Praxisalltag geregelt werden?
- Wie gelingt ein gutes Praxismanagement (z. B. Personalführung, Mitarbeiterbindung, Patientenzufriedenheit usw)
Wie hilft Ihnen Medizinio bei der Niederlassungsberatung?
Der Weg in die eigene Niederlassung ist mit vielen Herausforderungen verbunden – umso wichtiger ist es, von Beginn an professionelle Unterstützung an der Seite zu haben. Genau hier setzt Medizinio an: Als zentraler Ansprechpartner begleiten wir Sie durch alle Phasen der Niederlassung und sorgen dafür, dass Sie nicht den Überblick verlieren.
Die Gründung einer eigenen Praxis ist ein komplexes Vorhaben, an dem zahlreiche Akteure beteiligt sind – von Finanzberatern über Steuerexperten bis hin zu Rechtsanwälten. Statt sich selbst um jedes einzelne Detail kümmern zu müssen, profitieren Sie bei Medizinio von einem zentralen Zugang zu allen relevanten Kontakten. Wir bringen Sie gezielt mit den richtigen Experten zusammen – individuell, einfach, bedarfsgerecht und kostenfrei.
Doch unser Service endet nicht bei der Niederlassungsberatung: Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl und Beschaffung von Medizingeräten, Praxissoftware und weiteren Komponenten für Ihre zukünftige Praxis. So erhalten Sie alles aus einer Hand – effizient, professionell und mit einem starken Partner an Ihrer Seite.
Niederlassungsberatung der KVen
Wenn Sie eine Niederlassungsberatung durch eine Kassenärztliche Vereinigung wünschen, finden Sie hier die passenden Anlaufstellen:
KV Niederlassungsberatung
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen
- Niederlassungsberatung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe
FAQ
In welchem Alter lassen sich Ärzte nieder?
Ärzte lassen sich im Durchschnitt mit 42,3 Jahren nieder, meist nach der Facharztausbildung und klinischer Erfahrung. Dennoch gibt es auch Ärzte, die sich später im Berufsleben, beispielsweise nach längerer Tätigkeit im Krankenhaus oder in anderen medizinischen Einrichtungen, für die Niederlassung entscheiden.