Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Inhaltsverzeichnis
Was ist ein Thermodesinfektor?
Ein Thermodesinfektor, auch als Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) oder Desinfektionsautomat bekannt, ist ein medizinisches Gerät zur maschinellen Aufbereitung von wiederverwendbaren Instrumenten und Medizinprodukten. Er reinigt und desinfiziert diese unter Verwendung von heißem Wasser und speziellen Prozessmedien wie Reiniger, Neutralisator und Klarspüler. Ziel ist eine standardisierte, reproduzierbare und validierbare Aufbereitung gemäß den geltenden Hygienestandards.
Wichtige Merkmale eines Thermodesinfektors:
- Reinigung und Desinfektion: Entfernt zuverlässig organische Rückstände wie Blut, Eiweiße und Sekrete und führt gleichzeitig eine thermische Desinfektion durch.
- Prozessmedieneinsatz: Nutzt abgestimmte Chemikalien (Reiniger, Neutralisator, Klarspüler), um den Aufbereitungsprozess zu optimieren und Rückstände effektiv zu beseitigen.
- Thermische Desinfektion: Arbeitet in der Regel mit Temperaturen zwischen 90 und 95 °C, um eine keimreduzierende Wirkung zu erzielen.
- Automatisierter Ablauf: Der gesamte Prozess ist vollautomatisch, was eine gleichbleibende Qualität, Dokumentation und Nachverfolgbarkeit sicherstellt.
- Hygienische Sicherheit: Entspricht den Anforderungen an die instrumentelle Aufbereitung, z. B. gemäß DIN EN ISO 15883.
- Anwendungsbereiche: Findet Einsatz in Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie in Laboren.

Wie funktioniert ein Thermodesinfektor?
Ein Thermodesinfektor funktioniert ähnlich wie eine Spülmaschine, jedoch mit deutlich höheren Anforderungen an Hygiene, Validierbarkeit und Prozesssicherheit. Der gesamte Aufbereitungsprozess entspricht den Vorgaben der Normreihe EN ISO 15883, welche die Anforderungen an Reinigungs- und Desinfektionsgeräte regelt.
Funktionsweise eines Thermodesinfektors:
- Vorbereitung: Medizinprodukte müssen vor der maschinellen Aufbereitung gemäß den Herstellerangaben vorbereitet werden. Dazu gehören unter anderem das Zerlegen mehrteiliger Instrumente, das manuelle Entfernen grober Verschmutzungen sowie gegebenenfalls das Vorspülen mit Wasser.
- Beladung: Die Beladung des Thermodesinfektors erfolgt mit speziellen Beladungsträgern. Instrumente müssen so positioniert und fixiert werden, dass sämtliche Oberflächen – auch Innenräume von Hohlkörpern – frei zugänglich sind. Schattenwurf, der den Sprühstrahl blockieren könnte, ist zu vermeiden.
- Maschineller Prozess: Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät durchläuft mehrere automatisierte Schritte:
- Reinigung: Mit validierten, auf das Material abgestimmten Reinigungsmitteln (alkalisch oder enzymatisch) und mechanischem Sprühdruck werden organische Rückstände entfernt.
- Zwischenspülung: Mit klarem Wasser werden Reinigungsmittelreste entfernt, um chemische Reaktionen in den Folgeschritten zu vermeiden.
- Thermische Desinfektion: Die Instrumente werden bei einer Temperatur von mindestens 90 °C über eine definierte Haltezeit (z. B. 5–10 Minuten) thermisch desinfiziert. Ziel ist die sichere Inaktivierung pathogener Mikroorganismen, ohne chemische Rückstände zu hinterlassen.
- Endspülung: In der Regel erfolgt eine abschließende Spülung mit vollentsalztem Wasser (VE-Wasser), um Rückstände und Wasserflecken zu vermeiden.
- Trocknung: Die Trocknung erfolgt mittels gefilterter Warmluft oder Luftstrom. Sie verhindert die Rekontamination durch Feuchtigkeit und sorgt für eine sichere Lagerung der Instrumente.
- Protokollierung: Jeder Zyklus wird digital oder physisch dokumentiert. Die Protokolle enthalten unter anderem: Chargennummer, Temperaturverlauf, Programmdauer, Statusinformationen, mögliche Störungen sowie die Freigabe durch autorisiertes Personal. Diese lückenlose Rückverfolgbarkeit ist essenziell für die Qualitätssicherung und rechtliche Absicherung.
Eine Vorreinigung von Medizinprodukten ist dann zwingend erforderlich, wenn grobe oder angetrocknete Verschmutzungen wie Blut oder Gewebe vorhanden sind, eine zeitnahe maschinelle Aufbereitung nicht möglich ist oder das Instrument über schwer zugängliche Stellen wie Lumina oder Gelenke verfügt. Auch bei vorherigem Kontakt mit fixierenden Substanzen (z. B. Aldehyden) oder wenn dies in den Herstellerangaben gefordert wird, muss vorgereinigt werden. Ziel ist es, die Reinigungs- und Desinfektionsleistung im Thermodesinfektor nicht zu beeinträchtigen.
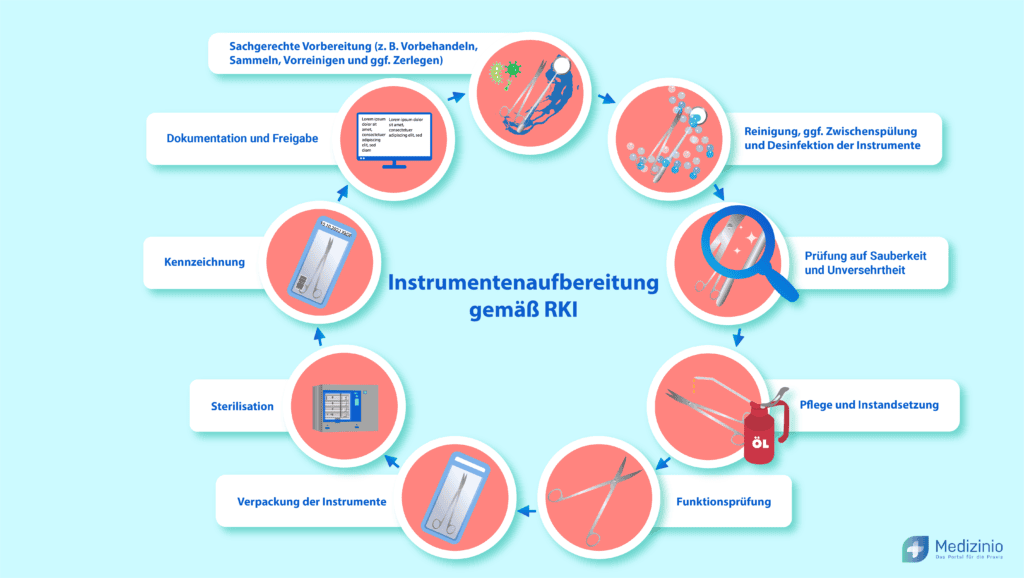


Ist ein Thermodesinfektor Pflicht in der Arztpraxis?
Ein Thermodesinfektor ist in der Arztpraxis nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben, kann jedoch in vielen Fällen faktisch als verpflichtend gelten. Die gemeinsame Empfehlung von KRINKO und BfArM zur Aufbereitung von Medizinprodukten stellt klare Anforderungen an die Qualität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit der Aufbereitung und verweist dabei auf die bevorzugte Nutzung maschineller Verfahren.
Rechtlicher und fachlicher Hintergrund:
- Aufbereitung mit validierten Verfahren: § 4 MPBetreibV (Medizinprodukte-Betreiberverordnung) fordert den Einsatz geeigneter, validierter Verfahren zur Reinigung und Desinfektion. Diese Validierung ist bei maschinellen Verfahren wie Thermodesinfektoren technisch sicher und nachvollziehbar umsetzbar. Manuelle Verfahren gelten als fehleranfälliger, schwer standardisierbar und bedürfen einer aufwendigen individuellen Validierung.
- Bevorzugung maschineller Verfahren: Die KRINKO/BfArM-Empfehlung weist mehrfach darauf hin, dass maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren gegenüber manuellen Verfahren den Vorzug erhalten sollen – insbesondere wegen ihrer Reproduzierbarkeit, besseren Wirksamkeit und Arbeitssicherheit.
- Kritische und semikritische Medizinprodukte: Für Medizinprodukte mit erhöhten hygienischen Anforderungen (z. B. Instrumente, die mit Schleimhäuten oder verletzter Haut in Kontakt kommen, oder in sterile Körperregionen eingeführt werden) ist laut Empfehlung eine grundsätzlich maschinelle Reinigung und thermische Desinfektion in RDG vorgesehen.
- Indirekte Verpflichtung durch Qualitätsanforderungen: Eine Arztpraxis, die regelmäßig semikritische oder kritische Medizinprodukte aufbereitet, kann die hohen Anforderungen an eine sichere, validierbare und dokumentierbare Aufbereitung in der Regel nur mit einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät erfüllen. Wird darauf verzichtet, muss die Praxis die Gleichwertigkeit manueller Verfahren im Rahmen eines dokumentierten Qualitätsmanagements nachweisen – ein in der Praxis kaum leistbarer Aufwand.
Welche Vorteile und Nachteile bietet ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät?
| Vorteile | Nachteile |
| Hoher Hygienestandard: Sicherstellung validierter Desinfektion durch standardisierte Prozesse | Hoher Anschaffungspreis: Investitionskosten sind oft vierstellig |
| Automatisierter Ablauf: Reduziert Personalaufwand und minimiert Fehlerquellen | Laufende Betriebskosten: Strom, Wasser und Reinigungsmittel verursachen laufende Kosten |
| Reproduzierbare Ergebnisse: Dokumentierte und nachvollziehbare Aufbereitung für Hygieneüberprüfungen | Platzbedarf: Gerät benötigt festen Standort mit Wasser- und Stromanschluss |
| Schonende Instrumentenaufbereitung: Minimiert mechanischen Abrieb im Vergleich zur manuellen Reinigung | Eingeschränkte Flexibilität: Nicht alle Instrumente sind für die maschinelle Aufbereitung geeignet |
| Zeitersparnis: Parallelisierung von Aufgaben durch automatisierten Reinigungsprozess | Wartungsaufwand: Regelmäßige technische Wartung notwendig zur Sicherstellung der Funktion |
| Erfüllung gesetzlicher Vorgaben: Unterstützung bei der Einhaltung der RKI-Richtlinien | Hohe initialer Aufwand: Schulung des Personals und Integration in Praxisabläufe erforderlich |
Welche Arten von Thermodesinfektoren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Thermodesinfektoren, die sich in Bauart, Funktion und Kapazität unterscheiden. Die wichtigsten Typen sind:
- Nach Bauform:
- Auftischgeräte: Kompakte Geräte, die auf Arbeitsflächen platziert werden und sich besonders für kleinere Praxen mit wenig Platz eignen.
- Einbau bzw. Unterbaugeräte: Werden fest in die Arbeitszeile integriert und bieten meist ein größeres Fassungsvermögen für Instrumente.
- Freistehende Geräte: Flexibel aufstellbar, oft mit größerem Volumen und bei hohem Instrumentenaufkommen ideal.
- Frontladegeräte: Be- und Entladung im selben Raum.
- Durchladegeräte (mit zwei Türen): Ermöglichen die Trennung zwischen unreinem und reinem Bereich zur Minimierung von Kontaminationsrisiken (z.B. in Kliniken/OP-Bereichen).
- Nach Ausstattung und Funktion:
- Mit aktiver Trocknung: Integrierte Heißlufttrocknung verhindert Restfeuchte auf den Instrumenten und beschleunigt die Trocknungszeit.
- Mit automatischer Dosierung: Geräte mit integrierten Dosiereinheiten für Reiniger und Neutralisator, die eine exakte und sichere Dosierung gewährleisten.
- Mit Prozessüberwachung und Dokumentation: Moderne Thermodesinfektoren bieten optionale oder integrierte Systeme zur Protokollierung und Überwachung der einzelnen Reinigungs- und Desinfektionszyklen (z.B. Sprüharm- und Dosierüberwachung).
- Nach Kapazität und Ausstattung für spezielle Aufgaben:
- Geräte mit unterschiedlichen Kammergrößen (z.B. für kleine Mengen oder große Chargen).
- Variabel mit Körben, Einsätzen für Hohlkörperinstrumente, Kassetten oder Kleinteile ausstattbar, je nach Anforderung.
Worauf sollte man beim Kauf eines Thermodesinfektors achten?
Die Anschaffung eines Thermodesinfektors ist keine rein technische Maßnahme, sondern eine wirtschaftlich und rechtlich relevante Investitionsentscheidung. Wer in seiner Praxis auf Qualität, Effizienz und Rechtssicherheit setzt, sollte bei der Auswahl gezielt auf konkrete Kaufkriterien achten, die den reibungslosen Einsatz und eine schnelle Amortisation des Geräts sichern.
Instrumententyp und Aufbereitungsanforderungen
Zunächst ist zu klären, welche Instrumente regelmäßig aufbereitet werden. Bei „kritisch B“-Instrumenten (z. B. rotierende Hohlkörper-Instrumente) ist eine maschinelle Reinigung und Desinfektion mit validierbarem Prozess gesetzlich vorgeschrieben. Geräte müssen diesen Anforderungen entsprechen und kompatibel mit entsprechenden Beladungsträgern sein.
Praxisrelevant: Je komplexer die Instrumente, desto höher der Anspruch an Programmvielfalt, Trocknungssystem und Validierbarkeit.
Aufbereitungskapazität, Kammergröße und Platzbedarf
Die Größe der Aufbereitungskammer sollte dem täglichen Instrumentenaufkommen entsprechen. Zu kleine Geräte führen zu Engpässen, überdimensionierte zu unnötigen Betriebskosten. Wichtig ist eine schnelle Zykluszeit bei gleichbleibender Reinigungsleistung. Der Thermodesinfektor muss zudem an vorhandene Anschlüsse (Wasser, Strom, ggf. Abluft) angepasst sein.
Empfehlung: Vorab Beladungspläne durchspielen lassen – gute Anbieter bieten hierfür Beratung oder Testgeräte.
Trocknung: Qualität und Funktion
Eine aktive Innen- und Außentrocknung ist wichtig, insbesondere bei Hohlkörpern oder empfindlichen Oberflächen. Sie verhindert Korrosion und Wasser-Fleckenbildung und macht die Instrumente sofort weiterverarbeitbar. Geräte mit integrierter Heißlufttrocknung bieten hier klare Vorteile gegenüber Modellen mit passiver Verdunstung.
Dokumentation und Prozessüberwachung
Die Prozessdokumentation ist gesetzlich verpflichtend. Ein modernes Reinigungs- und Desinfektionsgerät muss alle Zyklusdaten automatisch erfassen, speichern und exportierbar machen – z. B. via Netzwerk oder USB. Nur so kann die hygienische Sicherheit revisionssicher nachgewiesen werden.
Standard: DIN EN ISO 15883 – Geräte ohne Zertifizierung sollten ausgeschlossen werden.
Validierung und Wartungspflichten
Sowohl die Erstvalidierung als auch regelmäßige Revalidierungen müssen eingeplant werden. Dafür ist ein RDG-Gerät notwendig, das dafür technisch geeignet ist und vom Hersteller entsprechend unterstützt wird. Eine enge Zusammenarbeit mit validierungsfähigem Servicepersonal sichert die dauerhafte Funktionsfähigkeit.
Betriebskosten und Wirtschaftlichkeit
Neben dem Anschaffungspreis müssen die laufenden Kosten realistisch kalkuliert werden: Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungsmitteln sowie Wartungs- und Reparaturkosten. Geräte mit geringem Ressourcenverbrauch und zugelassenen, flexibel wählbaren Reinigungsmitteln senken langfristig die Betriebskosten.
Tipp: Wirtschaftlichkeitsrechnung über 5 Jahre einfordern, idealerweise inklusive Wartungsvertrag.
Bedienung, Service und Herstellerkompetenz
Eine benutzerfreundliche Oberfläche und selbsterklärende Menüführung erleichtern den Arbeitsalltag, verringern Fehler und verkürzen Einarbeitungszeiten. Entscheidend ist zudem ein zuverlässiger Hersteller mit schnellem Kundenservice, einem flächendeckenden Techniker-Netz und vertraglich zugesicherter Ersatzteilverfügbarkeit.
Zubehör
Der Einsatz eines Thermodesinfektors ist nur dann effizient und hygienisch sicher, wenn auch das passende Zubehör verwendet wird. Hochwertige Zubehörkomponenten optimieren die Beladung, sichern die Reinigungswirkung und tragen zur Prozessvalidierung bei. Eine gezielte Auswahl zahlt direkt auf Prozesssicherheit und Langlebigkeit des Geräts ein.
Zubehör für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
- Beladungsträger und Einsätze: Anpassbare Trays, Halterungen oder Körbe für unterschiedliche Instrumententypen, z. B. Hohlkörper-Instrumente, Hand- und Winkelstücke, ZEG-Spitzen oder Mikrochirurgie-Instrumente.
- Injektorschienen und Düsenmodule: Spezielle Aufnahmen für rotierende Instrumente, die eine gezielte Innenreinigung ermöglichen; entscheidend für die Aufbereitung von „kritisch B“-Instrumenten.
- Kleinteilesiebe und Deckelsiebe: Zur sicheren Aufbereitung loser oder sehr kleiner Instrumente; verhindern das Umherfliegen im Spülraum.
- Spüldornträger und Adaptersets: Für die sichere Fixierung von Hohlkörpern oder Instrumenten mit Lumen; oft herstellerspezifisch und auf bestimmte Produktlinien abgestimmt.
- Beladungswagen oder Transportwagen: Erleichtern das Be- und Entladen sowie den ergonomischen Transport der Trägersysteme innerhalb der Aufbereitungseinheit.
- Dosierpumpen und Chemikalienschläuche: Für die automatische und exakte Dosierung von Reinigungs- und Neutralisationsmitteln; müssen auf das Gerät und die eingesetzten Medien abgestimmt sein.
- Filtersysteme: Wasserfilter oder Partikelfilter zum Schutz sensibler Bauteile im Gerät sowie zur Sicherung der Wasserqualität im Reinigungsprozess.
- Wasseraufbereitungsanlage: Systeme wie Enthärtungsanlagen, Umkehrosmose oder Vollentsalzungseinheiten zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Wasserqualität; essenziell für fleckenfreie Aufbereitungsergebnisse und den Schutz vor Ablagerungen im Gerät.
- Reinigungsindikatoren: Validierte Prüfkörper zur Überwachung der Reinigungsleistung und Sichtbarmachung von Schwachstellen im Reinigungsprozess; unterstützen die Qualitätssicherung und Prozessvalidierung.
- Drucker und Speichermedien: Für die rechtssichere Ausgabe und Archivierung der Prozessdokumentation; z. B. Thermodrucker, USB-Sticks oder Netzwerkschnittstellen.
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Zugelassene, gerätekompatible Produkte mit validierten Wirkprofilen; im Idealfall herstellerunabhängig wählbar für mehr Flexibilität.
Endoskopaufbereitung: Spezielle Anforderungen an RDG-E
Wer in der Praxis Endoskope maschinell aufbereiten möchte, benötigt ein speziell dafür entwickeltes Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope (RDG-E). Diese Geräte erfüllen die besonderen Anforderungen hinsichtlich Spülkanalreinigung, Trocknung und mikrobieller Sicherheit, wie sie bei flexiblen Endoskopen vorgeschrieben sind.


Wie muss der Installationsort für einen Thermodesinfektor beschaffen sein?
Bevor Sie einen Thermodesinfektor kaufen, sollte der geplante Standort sorgfältig geprüft werden: Er beeinflusst maßgeblich die Einhaltung gesetzlicher Hygienevorgaben, die Betriebssicherheit und die Alltagstauglichkeit der gesamten Aufbereitungseinheit.
Räumliche Trennung: Unrein und rein müssen klar abgegrenzt sein
Gemäß den Vorgaben der KRINKO/BfArM-Empfehlungen ist eine funktionale Trennung der Aufbereitungseinheit in „unreine“ und „reine“ Bereiche zwingend erforderlich. Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät sollte so installiert werden, dass diese Trennung baulich und funktional unterstützt wird:
- Durchreichegeräte mit zwei Türen ermöglichen eine klare Trennung der Materialflüsse (Be- und Entladung auf unterschiedlichen Seiten).
- Alternativ kann die Trennung auch durch eine bauliche Abgrenzung im Aufbereitungsraum (z. B. Wandscheiben, Markierungen, Luftschleusen) erfolgen, sofern eine einseitige Geräteausführung verwendet wird.
Ziel: Vermeidung von Kreuzkontaminationen durch klare Wegeführung.
Technische Infrastruktur: Alle Anschlüsse müssen vorbereitet sein
Der Installationsraum muss über eine geeignete Versorgungsinfrastruktur verfügen:
- Wasseranschlüsse: Kaltwasseranschluss, ggf. Warmwasser und enthärtetes bzw. VE-Wasser, je nach Gerätespezifikation.
- Abwasseranschluss: Rückstausicherer Ablauf; RDG-Geräte mit eingebauter Ablaufpumpe bieten hier mehr Flexibilität.
- Stromversorgung: In der Regel 230 V, bei leistungsstärkeren Geräten 400 V (Drehstrom); passende Absicherung und eigener Stromkreis sind erforderlich.
- Lüftung: Bei Geräten ohne interne Dampfkondensation oder bei hoher Nutzungsfrequenz ist eine geeignete Raumlüftung notwendig, um Wasserdampf und kontaminierte Luft sicher abzuführen.
Tipp: Die technischen Anforderungen des Herstellers sollten vorab mit einem Fachinstallateur abgestimmt werden.
Hygiene und Raumgestaltung: Klima, Material und Reinigung
- Der Raum sollte gut belüftet, trocken und nicht überhitzt sein – zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Korrosion begünstigen.
- Boden und Wände müssen feucht abwischbar, chemikalienbeständig und rutschfest sein.
- Die Aufstellung muss die regelmäßige Reinigung des Geräts und seiner Umgebung ohne Einschränkungen ermöglichen.
Aufstellfläche, Zugänglichkeit und Ergonomie
- Der Thermodesinfektor muss stabil, vibrationsfrei und waagerecht aufgestellt werden, idealerweise auf ergonomischer Arbeitshöhe.
- Für Wartung, Validierung und Serviceeinsätze muss das Gerät rundum gut zugänglich sein. Empfohlen wird ein Mindestabstand zur Wand an den Seiten und nach hinten gemäß Herstellerangaben.
- Ausreichend Bewegungsfreiraum ist für das Fachpersonal ebenso notwendig wie eine klare und logische Anordnung der Beladungseinheiten, Ablagen und Chemikalienlager.
Welche Hersteller und Marken sind empfehlenswert?
Die Auswahl eines geeigneten Thermodesinfektors sollte nicht nur nach Preis und Ausstattung erfolgen, sondern auch unter Berücksichtigung der Herstellerkompetenz, Serviceverfügbarkeit, Ersatzteilversorgung und normgerechten Prozessführung. Am Markt haben sich einige Marken etabliert, die zuverlässig auf die Anforderungen von Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Krankenhäusern ausgerichtet sind.
Für niedergelassene Praxen mit typischem Aufbereitungsbedarf gelten MELAG und Miele als erste Wahl: Sie bieten ein hohes Maß an Prozesssicherheit, Gerätestabilität, ergonomischem Zubehör und technischem Support – bei gleichzeitig praxistauglicher Größe und Bedienbarkeit.
Andere Marken wie Belimed oder Getinge eignen sich insbesondere für größere Einrichtungen, OP-Zentren oder spezialisierte Fachpraxen mit erhöhtem Volumen.
MELAG (Deutschland)
- Positionierung: Spezialist für Praxishygiene mit Fokus auf niedergelassene Ärzte und Zahnärzte.
- Produkte: MELAtherm 10 ist das bekannteste Modell – kompakte Bauweise, integrierte Trocknung, validierbare Prozesse, umfangreiche Zubehörlinien.
- Stärken: RDG-Geräte speziell für kleine bis mittelgroße Praxen konzipiert, durchdachte Benutzerführung, umfassende Prozessdokumentation.
- Service: Weitreichendes Netz an Fachhändlern und geschultem Technikerpersonal; hohe Ersatzteilverfügbarkeit.
Miele Professional (Deutschland)
- Positionierung: Premiumhersteller mit breitem Portfolio für Praxen, Kliniken und Labore.
- Produkte: PG 858x-Serie (z. B. PG 8581), hochwertig verarbeitet, mit konfigurierbaren Beladungssystemen und modernem Prozessmanagement.
- Stärken: Robuste Bauweise, flexible Programmauswahl, sehr gute Langzeitstabilität.
- Service: Hervorragend ausgebauter Kundendienst mit schneller Reaktionszeit; besonders geeignet für größere Praxen mit hohem Instrumentenvolumen.
Euronda (Italien)
- Positionierung: Spezialist für Dentalhygiene mit Fokus auf die Bedürfnisse von Zahnarztpraxen.
- Produkte: Eurosafe
- Stärken: Kompakte Geräte mit intuitiver Bedienoberfläche, solide Reinigungsleistung für den Praxisalltag, durchdachte Kombination mit weiteren Hygienekomponenten des Herstellers.
- Service: Betreuung über autorisierte Fachhändler in Deutschland; technischer Support abhängig von regionalen Partnerstrukturen.
Steelco (Italien)
- Positionierung: Anbieter mit starkem Fokus auf Design, Effizienz und digitale Steuerungssysteme.
- Produkte: Untertischgeräte für kleine Einrichtungen ebenso wie Standgeräte für hohe Kapazitäten.
- Stärken: Innovative Technik, effiziente Programme, modernes Design.
- Service: In Deutschland über Fachhändler vertreten; Servicequalität abhängig vom Partnernetzwerk.
Belimed (Schweiz/Deutschland)
- Positionierung: Hersteller mit Schwerpunkt auf Kliniken, ambulante OP-Zentren und anspruchsvolle medizinische Einrichtungen.
- Produkte: Belimed WD-S und M-Serie für kleinere Aufbereitungseinheiten.
- Stärken: Technologisch hochwertige Geräte, durchgängige Prozessüberwachung, modulare Ausstattungsoptionen.
- Service: Starke Präsenz im Klinikbereich; in Praxen eher bei OP-Zentren und MVZs verbreitet.
Getinge (Schweden)
- Positionierung: Globaler Anbieter für ZSVA, OP-Bereiche und größere medizinische Versorgungsstrukturen.
- Produkte: Unter anderem Getinge 46- und 55-Serie – teilweise auch für ambulante Einrichtungen geeignet.
- Stärken: Hohe Zuverlässigkeit und umfangreiche Systemintegration; geeignet für größere Praxiseinheiten oder Verbundlösungen.
- Service: International ausgerichtet, mit Servicepartnern in Deutschland.


Wie viel kostet ein Thermodesinfektor?
Ein Thermodesinfektor kostet je nach Modell, Ausstattung und Hersteller zwischen 6.000 und 18.000 Euro netto. Für eine durchschnittliche Arztpraxis mit mittlerem Instrumentenaufkommen ist mit einem Gesamtbudget von rund 10.000 bis 12.000 Euro für Anschaffung, Zubehör und Installation zu rechnen. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten von etwa 1.000 bis 1.500 Euro, die Wartung, Reinigungsmittel, Wasser und Energie umfassen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren belaufen sich die Gesamtkosten somit auf ca. 16.000 bis 20.000 Euro netto.
- Anschaffungskosten (Netto, ohne Installation)
- Basismodelle für kleine Praxen (z. B. MELAG MELAtherm 10 Basic, SMEG WD116):
- ca. 6.000 – 8.000 Euro
- Eignen sich für einen geringeren Instrumentendurchsatz, oft ohne integrierte Trocknung oder nur mit einfacher Dokumentation.
- Modelle mit integrierter Trocknung und Dokumentation (z. B. MELAtherm 10 Evolution, Miele PG 8581):
- ca. 8.000 – 12.000 Euro
- Häufigster Einsatzbereich in Einzel- und Gemeinschaftspraxen; gute Balance aus Ausstattung und Wirtschaftlichkeit.
- Hochwertige Geräte für größere Praxen oder OP-Zentren (z. B. Miele PG 8592, Getinge oder Belimed-Serie):
- 12.000 – 18.000 Euro und mehr
- Höhere Kapazität, individuelle Programmoptionen, leistungsfähigere Trocknung und komplexere Anbindung an IT/Dokumentation.
- Basismodelle für kleine Praxen (z. B. MELAG MELAtherm 10 Basic, SMEG WD116):
- Zusätzliche Investitionskosten
- Zubehör: Beladungsträger, Hohlkörperadapter, Instrumentenhalterungen: 500 – 1.500 Euro
- Installationskosten: Wasser, Strom, Abwasseranschluss inkl. Installation: ca. 500 – 1.000 Euro
- Validierung (Erstvalidierung nach MPBetreibV): ca. 600 – 1.200 Euro
- Software/Dokumentationssysteme (falls nicht integriert): je nach Lösung bis 1.500 Euro
- Laufende Betriebskosten (jährlich, Durchschnittswerte)
- Wasser und Energie: ca. 200 – 400 Euro/Jahr je nach Nutzungshäufigkeit
- Reinigungsmittel und Chemikalien: ca. 500 – 900 Euro/Jahr
- Wartung und Service (inkl. Revalidierung, Verschleißteile): ca. 400 – 800 Euro/Jahr
Welche Alternativen gibt es zum Thermodesinfektor?
Die primäre Alternative zum Thermodesinfektor ist die manuelle Reinigung und Desinfektion. Sie ist grundsätzlich zulässig, wenn kein maschinelles Verfahren verfügbar ist oder sich für bestimmte Instrumente als ungeeignet erweist. Dennoch gelten für diese Vorgehensweise deutlich strengere Anforderungen:
- Zulässigkeit: Die manuelle Aufbereitung ist erlaubt, wenn ein maschinelles Verfahren nicht zur Verfügung steht oder nicht geeignet ist.
- Validierungspflicht: Es muss nachgewiesen werden, dass das manuelle Verfahren in Bezug auf Reinigung und Desinfektion ebenso sicher, wirksam und reproduzierbar ist wie eine maschinelle Aufbereitung.
- Dokumentationspflicht: Jeder einzelne Schritt der manuellen Aufbereitung ist lückenlos zu dokumentieren, inklusive Verfahrensbeschreibung und regelmäßiger Schulungen des Personals.
- Erhöhte Anforderungen bei bestimmten Medizinprodukten: Bei Produkten der Klassifikation semikritisch B oder kritisch B/C ist eine manuelle Aufbereitung nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig und bedarf einer besonders sorgfältigen Dokumentation.
- Empfehlung für maschinelle Verfahren: Aufgrund der geringeren Fehleranfälligkeit und der besseren Validierbarkeit sind maschinelle Verfahren grundsätzlich zu bevorzugen.
In der Praxis bleibt der Einsatz eines Thermodesinfektors somit der empfohlene Standard. Die manuelle Aufbereitung ist eine mögliche, jedoch aufwendigere und fehleranfälligere Alternative, die nur unter strengen Auflagen eingesetzt werden darf.
FAQ
Welche Temperaturen hat ein RDG?
Ein RDG erreicht während der thermischen Desinfektion in der Regel Temperaturen zwischen 80 °C und 95 °C. Diese Temperaturbereiche sind notwendig, um eine wirksame Abtötung von Mikroorganismen sicherzustellen und die Anforderungen an die hygienische Aufbereitung zu erfüllen.
Wie oft muss ein Thermodesinfektor validiert werden?
Ein Thermodesinfektor muss gemäß DIN EN ISO 15883-1:2014-10 regelmäßig validiert werden. Die Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) empfiehlt hierfür ein jährliches Intervall. Eine erneute Validierung (Revalidierung) ist außerdem erforderlich, wenn technische Änderungen oder Wartungsarbeiten die Geräteleistung beeinflussen, wenn Routineprüfungen Abweichungen zur Erstvalidierung zeigen, wenn Prozessparameter wie beispielsweise Reinigungschemikalien verändert wurden oder wenn das festgelegte Validierungsintervall erreicht ist. Abweichungen von der jährlichen Überprüfung sind nur zulässig, wenn sie fachlich begründet und nachvollziehbar dokumentiert werden.
Welche Wasserqualität benötigt ein Thermodesinfektor?
Ein Thermodesinfektor benötigt demineralisiertes oder vollentsalztes Wasser. Die Verwendung von aufbereitetem Wasser verhindert Kalk- und Salzablagerungen und trägt wesentlich zur Schonung der Instrumente und zur Funktionstüchtigkeit des Geräts bei.
Darf man einen Thermodesinfektor selbst aufstellen?
Das eigenständige Aufstellen eines Thermodesinfektors durch den Betreiber ist nicht zulässig, sofern dabei nicht sämtliche Anforderungen an eine fachgerechte Installation und Validierung erfüllt werden.
Gemäß der Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI muss vor Inbetriebnahme eines Reinigungs-Desinfektionsgeräts zunächst eine Installationsqualifikation (IQ) durchgeführt werden. Diese stellt sicher, dass das Gerät am vorgesehenen Ort korrekt aufgestellt, angeschlossen und betriebsbereit ist. Erst wenn alle baulich-technischen Voraussetzungen erfüllt sind – insbesondere die Trennung von reinem und unreinem Bereich sowie die ordnungsgemäße Medienversorgung – kann eine Validierung erfolgen. Diese umfasst zusätzlich zur Installationsqualifikation auch eine Betriebsqualifikation (BQ) und eine Leistungsqualifikation (LQ).
Die Validierung darf ausschließlich von sachkundigem Fachpersonal mit entsprechender Qualifikation und geeigneter Messtechnik durchgeführt werden. Ein unsachgemäßes oder eigenmächtiges Aufstellen des Thermodesinfektors ohne diese qualifizierten Maßnahmen widerspricht den Anforderungen der Leitlinie und stellt ein erhebliches Risiko für die Sicherheit und Wirksamkeit der Aufbereitung dar. Daher ist das eigenständige Aufstellen eines Thermodesinfektors ohne Fachpersonal und ohne dokumentierte Validierung nicht erlaubt.
Was ist ein DAC im zahnärztlichen Kontext?
Ein DAC im zahnärztlichen Kontext ist ein spezieller Dampfautoklav zur maschinellen Aufbereitung von rotierenden zahnärztlichen Instrumenten wie Turbinen, Hand- und Winkelstücken. Der Begriff bezieht sich meist auf das Gerät „DAC Universal“ des Herstellers Dentsply Sirona, einem weltweit führenden Anbieter dentaler Technologien.
Wie lange dauert ein kompletter Desinfektionszyklus?
Ein vollständiger Desinfektionszyklus in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät dauert je nach Gerätemodell und gewähltem Programm in der Regel zwischen 40 und 60 Minuten. Der Ablauf umfasst die Schritte Vorreinigung, Reinigung, thermische Desinfektion sowie Trocknung. Die kürzesten Schnellprogramme benötigen etwa 20 bis 30 Minuten und beinhalten die Reinigung und Desinfektion, meist jedoch ohne Vorreinigung und ohne oder nur mit verkürzter Trocknungsphase.
Was bedeutet A0-Wert 3000?
Der A0-Wert 3000 beschreibt die Wirksamkeit thermischer Desinfektionsverfahren und ist ein standardisierter Kennwert gemäß EN DIN ISO 15883-1. Er gibt an, wie stark Mikroorganismen durch feuchte Hitze abgetötet werden, wobei Temperatur und Einwirkzeit in ihrer Gesamtheit bewertet werden. Konkret bedeutet ein A0-Wert von 3000, dass bei einer Temperatur von 90 °C eine Haltezeit von fünf Minuten eingehalten wird. Dieser Wert ist erforderlich, um nicht nur Bakterien, Pilze und thermolabile Viren, sondern auch widerstandsfähige Erreger wie Hepatitis B-Viren zuverlässig zu inaktivieren. Deshalb ist der A0-Wert 3000 insbesondere für die maschinelle Aufbereitung chirurgischer Instrumente in RDG-Geräten verbindlich festgelegt.
Was ist der Unterschied zwischen Thermodesinfektor und Autoklav?
Der Hauptunterschied zwischen Thermodesinfektor und Autoklav ist die Funktion: Ein Thermodesinfektor reinigt und desinfiziert bei 80–95 °C, erreicht aber keine Sterilität. Ein Autoklav sterilisiert bei 121–134 °C mit gesättigtem Wasserdampf unter Druck und tötet alle Mikroorganismen, einschließlich Sporen, vollständig ab. Erfahren Sie hier mehr darüber, was ein Autoklav ist und wie er funktioniert.

