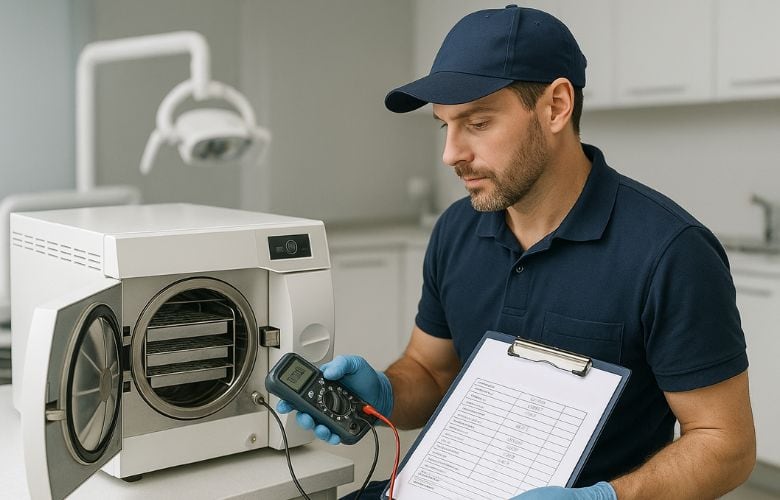Schneller Service
Kostenlose Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Erfolg durch Erfahrung
Aus über 15.000 Projekten im Jahr wissen wir, worauf es ankommt
Der digitale Marktführer
Unsere Kunden sprechen für uns:
4,9 von 5 Sternen auf Google
Das Wichtigste auf einen Blick
- Die Validierung eines Autoklaven ist nach MPBetreibV §8 und DIN EN ISO 17665 verpflichtend und liefert den dokumentierten Nachweis, dass Temperatur, Druck und Haltezeit reproduzierbar die geforderte Sterilität erreichen.
- Standardmäßig ist eine jährliche Validierung vorgeschrieben; ein Intervall von bis zu zwei Jahren ist nur zulässig bei nachgewiesener Prozessstabilität, regelmäßiger Wartung und lückenloser Chargendokumentation.
- Der Qualifizierungsablauf umfasst Design‑ (DQ), Installations‑ (IQ), Funktions‑ (OQ) und Leistungsqualifizierung (PQ) mit Praxisläufen, Bioindikatoren (z. B. Geobacillus stearothermophilus) sowie Temperatur‑ und Dampfdurchdringungsmessungen; Erstvalidierungen dauern vor Ort typischerweise 2–5 Stunden und kosten etwa 500–1.700 € (Revalidierungen ca. 400–1.000 €) zzgl. MwSt. und Anfahrt.
Inhaltsverzeichnis
Was bedeutet Validierung bei einem Autoklaven?
Die Validierung eines Autoklaven beschreibt einen dokumentierten Nachweis, dass das Gerät zuverlässig und reproduzierbar die geforderte Sterilisation von Medizinprodukten gewährleistet. Dabei wird überprüft, ob der Autoklav unter realen Bedingungen die vorgegebenen Prozessparameter – wie Temperatur, Druck und Zeit – konstant einhält und somit die mikrobiologische Sicherheit der aufbereiteten Instrumente sicherstellt.
Die Validierung ist nicht mit einer einfachen Funktionsprüfung gleichzusetzen. Sie geht deutlich darüber hinaus und umfasst eine systematische Bewertung aller Schritte des Sterilisationsprozesses. Ziel ist es, den gesamten Aufbereitungsprozess nachvollziehbar zu dokumentieren und zu bestätigen, dass alle eingesetzten Verfahren sicher, wirksam und gesetzeskonform ablaufen.
In Deutschland ist die Validierung von Autoklaven gemäß der Normenreihe DIN EN ISO 17665-1 sowie der Richtlinie des Robert Koch-Instituts (RKI) in Verbindung mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) verpflichtend. Besonders bei der Aufbereitung von sogenannten „kritischen Medizinprodukten“ – also Instrumenten, die mit Blut, Gewebe oder offenen Wunden in Kontakt kommen – ist eine validierte Sterilisation gesetzlich vorgeschrieben.
Kurz gesagt: Die Validierung liefert den belastbaren Nachweis, dass der Autoklav die geforderte Sterilität zuverlässig erreicht – und zwar nicht nur im Idealfall, sondern im täglichen Routinebetrieb.
Sie möchten einen Autoklaven kaufen – neu oder gebraucht? Profitieren Sie vom großen Medizinio-Partnernetzwerk und kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie kostenlos.
Wie oft muss ein Autoklav validiert werden?
Ein Autoklav muss in der Regel einmal jährlich validiert werden. Dies schreibt die internationale Norm DIN EN ISO 17665 vor und gilt als Standard in medizinischen Einrichtungen.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Validierungsintervall jedoch verlängert werden: Laut der nationalen Norm DIN SPEC 58929 ist ein Intervall von bis zu zwei Jahren zulässig, wenn eine nachgewiesene Prozessstabilität, regelmäßige Wartung sowie eine lückenlose Dokumentation und Auswertung aller Chargen vorliegen.
Im Praxisalltag bedeutet das:
- Standardintervall: jährlich
- Verlängertes Intervall: maximal alle zwei Jahre, nur bei nachgewiesener Prozessstabilität
Trotz möglicher Verlängerung ist eine kontinuierliche Prozessüberwachung erforderlich, beispielsweise durch Routinetests und die lückenlose Auswertung aller Chargen. Die Entscheidung über das konkrete Validierungsintervall sollte stets in Abstimmung mit einem Fachbetrieb erfolgen.
Wann ist eine Validierung notwendig?
Die Validierung eines Autoklaven ist verpflichtend:
- vor der ersten Inbetriebnahme,
- nach wesentlichen technischen Veränderungen,
- oder bei Umstellung von Beladungsmustern, Verpackungssystemen oder Prozessparametern.
Im laufenden Betrieb muss regelmäßig eine periodische Verfahrensprüfung durchgeführt werden. Diese dient dazu zu bestätigen, dass:
- keine unbeabsichtigten Prozessveränderungen aufgetreten sind,
- die im Validierungsprotokoll definierten Parameter dauerhaft eingehalten werden,
- die Reproduzierbarkeit und Wirksamkeit des Verfahrens auch im Zeitverlauf sichergestellt bleibt.
Typischerweise erfolgt diese Prüfung jährlich, kann jedoch in Abhängigkeit von Risikobewertung, Geräteart und Herstellerangaben auch in anderen Intervallen erforderlich sein. Sie sollte möglichst mit Wartungsmaßnahmen kombiniert werden, um betriebliche Ausfallzeiten zu minimieren.
Zusätzlich zur periodischen Prüfung sind ereignisbezogene Prüfungen durchzuführen, wenn es zu Veränderungen oder Störungen kommt, die potenziell Einfluss auf den Sterilisationsprozess haben. Hierzu zählen insbesondere:
- Reparaturen oder technische Modifikationen am Autoklaven,
- Software- oder Firmware-Updates,
- Änderungen bei Beladung, Verpackung oder Instrumentenarten,
- Auffälligkeiten im Rahmen der Prozessüberwachung oder Prüfprotokolle.
Ziel dieser Prüfungen ist es, die Validität des Sterilisationsprozesses unter den veränderten Bedingungen erneut zu bestätigen.
Was muss alles validiert werden?
Im Rahmen der Medizinprodukte- und Instrumentenaufbereitung muss nicht nur der Autoklav selbst validiert werden, sondern der gesamte Sterilisationsprozess – von der Reinigung bis zur Freigabe der sterilisierten Instrumente. Die Validierung betrifft daher sämtliche Verfahrensschritte, die Einfluss auf das Ergebnis der Sterilisation haben.
Folgende Bereiche sind typischerweise zu validieren:
- Der Autoklav: Das zentrale Gerät für die Dampfsterilisation muss validiert werden, um nachzuweisen, dass es unter Routinebedingungen zuverlässig die geforderte Sterilität erreicht. Dabei werden die physikalischen Prozessparameter (z. B. Temperatur, Druck, Haltezeit) messtechnisch überprüft.
- Beladungsschema und Verpackung: Die Art und Weise, wie Instrumente verpackt und im Autoklaven platziert werden, beeinflusst die Dampfdurchdringung und somit die Wirksamkeit der Sterilisation. Auch diese Abläufe sind fester Bestandteil der Validierung.
- Chargendokumentation und Prozessfreigabe: Die lückenlose Aufzeichnung jeder Sterilisationscharge, inklusive der Auswertung von Prozessindikatoren und Freigabevermerke, gehört ebenfalls zur validierungspflichtigen Prozesskette.
- Reinigung und Desinfektion: Die maschinelle Reinigung und Desinfektion mit einem Thermodesinfektor – ist ein zwingender Bestandteil der Aufbereitung und muss validiert werden. Nur hygienisch einwandfrei vorgereinigte Medizinprodukte dürfen sterilisiert werden, da Verschmutzungen die Wirksamkeit des Sterilisationsprozesses beeinträchtigen können.
- Wasserqualität: Die eingesetzte Wasserqualität (z. B. demineralisiertes Wasser) hat Einfluss auf die Materialschonung und Sterilisationsergebnisse. Eine Prüfung im Rahmen der Validierung ist sinnvoll und in vielen Fällen gefordert.
Zusammengefasst gilt: Validiert wird nicht nur das Gerät, sondern der komplette Aufbereitungsprozess. Nur wenn alle relevanten Faktoren überprüft, dokumentiert und als sicher bewertet wurden, gilt der Prozess als validiert.
Wie viel kostet einen Autoklav-Validierung?
Die Kosten für eine Autoklav-Validierung hängen von mehreren Faktoren ab, insbesondere davon, ob es sich um eine Erstvalidierung oder eine Revalidierung handelt. Eine Erstvalidierung ist aufwändiger, da die Leistungsqualifikation dreifach durchgeführt werden muss. Sie kostet ungefähr zwischen 500 und 1.700 Euro zzgl. MwSt und ggf. Anfahrtskosten. Bei einer Revalidierung reduziert sich der Prüfaufwand, da meist nur ein Zyklus validiert wird. Die Kosten liegen hier typischerweise zwischen 400 und 1.000 Euro.
Zusätzlich ist zu beachten, dass die Größe des Autoklaven einen erheblichen Einfluss auf die Validierungskosten hat. Bei Großautoklaven ist der Aufwand deutlich höher als bei kleineren Geräten. Dies liegt unter anderem an der komplexeren Beladung, längeren Prozesszeiten sowie dem erhöhten Dokumentations- und Prüfaufwand. Entsprechend fallen die Kosten bei einem Großautoklaven in der Regel spürbar höher aus als bei einem kleinen Tischautoklaven.
Darüber hinaus muss auch das relevante Zubehör wie beispielsweise Siegelgeräte im Rahmen der Validierung berücksichtigt werden. Deren Prüfung ist essenziell, da sie direkten Einfluss auf die Prozesssicherheit und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen haben.
Welche rechtlichen Grundlagen und Normen gelten?
Medizinprodukte-Betreiberverordnung
Die Validierung von Autoklaven in der Medizin ist nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) zwingend vorgeschrieben, wenn diese zur Aufbereitung von Medizinprodukten eingesetzt werden. Im Mittelpunkt steht dabei § 8 MPBetreibV, der die rechtlichen Anforderungen an die Aufbereitung – und damit auch an die Validierung – regelt.
- Rechtsgrundlage
- MPBetreibV § 8 Abs. 1: Aufbereitung (inkl. Dampfsterilisation im Autoklaven) muss mit geeigneten, validierten Verfahren erfolgen.
- Ziel: Sicherstellung eines reproduzierbaren, wirksamen und nachvollziehbaren Sterilisationsprozesses – im Einklang mit den Herstellerangaben.
- Vermutungsregel (§ 8 Abs. 2)
- Eine ordnungsgemäße Validierung wird vermutet, wenn die RKI-/BfArM-Empfehlung zur Aufbereitung von Medizinprodukten eingehalten wird.
- Diese Empfehlung stellt den allgemein anerkannten Stand der Technik in Deutschland dar.
- Zertifizierungspflicht (§ 8 Abs. 3)
- Gilt bei Produkten der Risikogruppe „kritisch C“ (z. B. chirurgische Instrumente mit komplexer Geometrie).
- Notwendig ist die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems durch eine benannte Stelle nach § 17b MPDG.
- Qualifikationsanforderungen (§ 8 Abs. 4 i. V. m. § 5 MPBetreibV)
- Die Validierung darf nur durch Personen erfolgen, die:
- über eine geeignete Ausbildung und einschlägige Berufserfahrung verfügen,
- hinsichtlich der Beurteilung weisungsfrei sind,
- über geeignete Prüfmittel, Räume und Geräte verfügen.
- Alternativ können anerkannte fachspezifische Fortbildungen als Qualifikationsnachweis dienen.
- Die Validierung darf nur durch Personen erfolgen, die:
- Pflichten des Betreibers
- Beauftragung nur von qualifizierten Fachkräften oder Dienstleistern.
- Sicherstellung der Dokumentation und regelmäßigen Überprüfung der Validierung.
- Behörden sind berechtigt, die Einhaltung aller Anforderungen zu kontrollieren.
- Sanktionen (§ 19 MPBetreibV)
- Verstöße gegen § 8 gelten als Ordnungswidrigkeit.
- Bußgelder drohen bei:
- fehlender oder unzureichender Validierung,
- Einsatz ungeeigneter Personen oder Verfahren.
Technische Normen
- DIN EN ISO 17665-1:
- Titel: „Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Feuchte Hitze – Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Routinekontrolle eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte“
- Diese Norm beschreibt den validierten Einsatz der Dampfsterilisation in medizinischen Einrichtungen.
- DIN EN ISO 13485:
- Qualitätsmanagementsysteme für Medizinproduktehersteller. Beinhaltet auch Anforderungen an Prozessvalidierung.
- DIN EN ISO 14937 (ergänzend):
- Allgemeine Anforderungen an die Validierung von Sterilisationsverfahren für Medizinprodukte.
- DIN EN 285:
- Gilt für Großsterilisatoren mit Wasserdampf.
- Legt Anforderungen an Konstruktion, Betrieb und Validierung fest.
- Diese Norm ist in Deutschland verpflichtend für Krankenhäuser und zentrale Sterilgutversorgungsabteilungen (ZSVA).
- DIN 58946 (Teile 1 und 2)
- Titel: „Dampf-Sterilisatoren – Anforderungen an den Betrieb und bauliche Voraussetzungen“
- DIN EN 554 (zurückgezogen, aber historisch relevant)
- Titel: „Sterilisation von Medizinprodukten – Validierung und Routineüberwachung – Dampfsterilisation“
- Diese Norm wurde durch DIN EN ISO 17665 ersetzt, war aber lange die zentrale Vorschrift für die Validierung von Autoklaven.
- Sie beeinflusst noch heute viele betriebliche Verfahren und dient weiterhin als Referenz in Altvalidierungen und älteren QM-Systemen.
Weitere Leitlinien: DGSV, DGKH und AKI
Die Leitlinien der DGSV, DGKH und des AKI stellen eine fachlich fundierte, praxisnahe Ergänzung zu den gesetzlichen Anforderungen dar. Sie fördern die Standardisierung und Qualität in der Aufbereitung und Validierung von Autoklaven. In der Praxis sind sie ein unverzichtbares Hilfsmittel für Hygienebeauftragte MFA, Sterilgutassistenten, Validierer und Betreiber medizinischer Einrichtungen. Ihre Anwendung erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch die rechtliche Absicherung im Rahmen des Qualitätsmanagements (insbesondere Hygienemanagements) und Behördenprüfungen.
- DGSV – Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung e. V.: Die DGSV erarbeitet regelmäßig fachliche Leitlinien, Handreichungen und Schulungsunterlagen zur Aufbereitung von Medizinprodukten. Ihre Empfehlungen sind in vielen Krankenhäusern und Aufbereitungseinheiten Standard.
- DGKH – Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V.: Die DGKH entwickelt evidenzbasierte Hygieneleitlinien für den stationären und ambulanten Bereich. Ihre Empfehlungen werden in enger Abstimmung mit dem RKI erarbeitet und gelten als fachlich maßgeblich.
- AKI – Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung: Der AKI ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von Experten aus Industrie, Forschung, Klinik und Dienstleistungssektor, der praxisorientierte Leitlinien und Schulungsmaterialien zur Instrumentenaufbereitung veröffentlicht.
Wie läuft die Validierung eines Autoklaven ab?
Die Validierung eines Autoklaven erfolgt in mehreren klar definierten Phasen. Ziel ist die dokumentierte Gewährleistung, dass der Sterilisationsprozess unter Routinebedingungen reproduzierbar sichere Ergebnisse liefert. Grundlage sind die Anforderungen der MPBetreibV, die KRINKO/BfArM-Empfehlungen sowie die Norm DIN EN ISO 17665.
Obwohl die Begriffe Qualifizierung und Validierung häufig gemeinsam genannt oder sogar synonym verwendet werden, stehen sie für unterschiedliche Konzepte mit jeweils eigenen Zielsetzungen und Vorgehensweisen.
Alle Maßnahmen sind Bestandteil eines etablierten Qualitätsmanagementsystems (z. B. nach DIN EN ISO 13485) und müssen dokumentiert, ausgewertet und regelmäßig überprüft werden.
Design-Qualifizierung: Fundament der Validierung
Die Designqualifizierung (DQ) ist der erste dokumentierte Schritt im Qualifizierungsprozess eines Autoklaven. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das geplante Design – einschließlich Konstruktion, Komponenten und Steuerung – den Anforderungen des vorgesehenen Verwendungszwecks entspricht.
Im Zentrum steht dabei die sogenannte User Requirement Specification (URS), in der alle relevanten Anforderungen an den Autoklaven definiert werden. Dazu zählen Parameter wie Temperatur, Druck, Kammervolumen oder Beladungstypen. Auf Basis dieser Spezifikation wird das Design des Geräts überprüft und mit den technischen Möglichkeiten des Herstellers abgeglichen. Auch normkonforme Aspekte wie Sicherheitsfunktionen und Dokumentationspflichten werden dabei berücksichtigt.
Die DQ stellt sicher, dass die geplante Konfiguration prinzipiell validierfähig ist. Erst nach dieser Freigabe erfolgt die Vorbereitung der weiteren Qualifizierungsstufen IQ, OQ und PQ.
Installationsqualifizierung: Prüfung der fachgerechten Inbetriebnahme
Die Installationsqualifizierung (IQ) dient der systematischen Überprüfung, ob das Gerät korrekt installiert wurde und den Vorgaben des Herstellers entspricht. Für Arztpraxen ist dies ein zentraler Schritt, um die Betriebssicherheit sicherzustellen.
Im Rahmen der IQ wird kontrolliert, ob alle Versorgungsanschlüsse – also Dampf, Druckluft, Wasser und Elektrik – funktionstüchtig sind. Ebenso wird geprüft, ob alle sicherheitsrelevanten Komponenten vorhanden und betriebsbereit sind. Dazu gehören unter anderem Druckbegrenzungseinrichtungen oder Not-Aus-Systeme. Auch die technische Dokumentation muss vollständig vorliegen, inklusive CE-Konformität und Herstellernachweisen.
Die IQ wird mit einer formalen Dokumentation abgeschlossen. Diese bestätigt, dass der Autoklav korrekt installiert wurde und einsatzbereit ist – ein wichtiger Schritt, bevor erste Sterilisationsprozesse unter realen Bedingungen getestet werden dürfen.
Funktionsqualifizierung: Technische Prüfung unter kontrollierten Bedingungen
Die Funktionsqualifizierung (Operational Qualification, OQ) stellt sicher, dass der Autoklav unter definierten Bedingungen einwandfrei arbeitet. Dabei geht es nicht um die tatsächliche Sterilisation von Beladungsgütern, sondern um die Überprüfung der technischen Funktionalität im Leerlauf und unter standardisierten Bedingungen.
Zu den Kernpunkten der OQ gehören die Prüfung der programmierten Prozessparameter wie Temperatur, Druck und Haltezeit sowie die Kontrolle von Steuerung, Anzeige- und Alarmsystemen. Darüber hinaus werden die Regelkreise und die verbaute Sensorik dokumentiert. In mehreren Leerzyklen wird außerdem geprüft, ob die Prozesse reproduzierbar ablaufen.
Für Ärzte, die mit den Ergebnissen dieser Phase arbeiten, ist vor allem eines entscheidend: Die OQ liefert den Nachweis, dass der Autoklav in der Lage ist, die vorgegebenen technischen Parameter konstant und zuverlässig einzuhalten. Nur wenn diese Grundlage erfüllt ist, kann die sichere Sterilisation von Medizinprodukten gewährleistet werden.
Leistungsqualifizierung: Nachweis der Wirksamkeit unter realen Bedingungen
Die Leistungsqualifizierung (Performance Qualification, PQ) schließt den Validierungsprozess ab. In dieser Phase wird geprüft, ob der Autoklav unter tatsächlichen Alltagsbedingungen zuverlässig sterilisiert. Dabei steht die praktische Prozesswirksamkeit im Mittelpunkt.
Durchgeführt werden unter anderem Testläufe mit realen Beladungsmustern, einschließlich sogenannter „Worst-Case“-Szenarien, die besonders schwer zu sterilisierende Konfigurationen abbilden. In kritischen Positionen der Beladung werden Bioindikatoren – typischerweise Geobacillus stearothermophilus – eingesetzt. Ergänzt wird die Überprüfung durch Temperatur- und Dampfdurchdringungsmessungen mit Thermologgern.
Die Leistungsbeurteilung liefert den Beweis, dass der Autoklav auch im Praxisbetrieb zuverlässig funktioniert und eine vollständige Inaktivierung mikrobieller Kontamination gewährleistet ist. Dies ist insbesondere für medizinisches Personal von Bedeutung, das sich auf eine reproduzierbare und sichere Aufbereitung medizinischer Instrumente verlassen muss.
Revalidierung und kontinuierliche Überwachung: Sicherheit im laufenden Betrieb
Nach Abschluss der Erstvalidierung ist die Arbeit nicht beendet. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Sterilisationsprozesse langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Revalidierungen erforderlich.
Diese erfolgen entweder periodisch – zum Beispiel jährlich oder nach normativen Vorgaben – oder anlassbezogen, etwa nach technischen Änderungen, Reparaturen oder Softwareupdates. Auch Veränderungen beim Beladungsschema können eine erneute Validierung notwendig machen.
Im täglichen Betrieb müssen zusätzlich Routineprüfungen durchgeführt werden, darunter Chargenkontrollen, der Bowie-Dick-Test zur Überprüfung der Dampfdurchdringung sowie Vakuumtests. Diese kontinuierliche Überwachung stellt sicher, dass der Autoklav dauerhaft normgerecht arbeitet und den hohen hygienischen Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht wird.
Welche Unterlagen erhält man nach der Autoklav-Validierung?
Nach Abschluss einer Validierung erhält der Betreiber mehrere verbindliche Dokumente, die den erfolgreichen Nachweis eines normgerechten Sterilisationsprozesses belegen.
Im Zentrum steht der Validierungsbericht, der alle Prüfschritte – von der Installations- über die Funktions- bis zur Leistungsqualifizierung – vollständig dokumentiert. Ergänzt wird dieser durch eine formelle Freigabebescheinigung, aus der hervorgeht, dass der Autoklav unter den geprüften Bedingungen sicher betrieben werden darf. Hinzu kommen Messprotokolle mit den aufgezeichneten Temperatur-, Druck- und Zeitverläufen, die die Einhaltung der Sterilisationsparameter belegen. Die validierten Beladungsschemata werden ebenfalls festgehalten, häufig inklusive Fotos oder Skizzen zur eindeutigen Zuordnung. Falls bei der Prüfung Abweichungen festgestellt wurden, enthält die Dokumentation konkrete Hinweise zur Prozessoptimierung.
Diese Unterlagen müssen dauerhaft aufbewahrt, regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden – sie bilden die Grundlage für rechtssicheren Betrieb und behördliche Nachweispflicht.
Welche Voraussetzungen für die Validierung eines Autoklaven müssen erfüllt sein?
Für die Validierung eines Autoklaven müssen laut den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene eine Reihe technischer, organisatorischer und dokumentarischer Voraussetzungen erfüllt sein. Diese umfassen insbesondere:
- Gerätedokumentation: Der Betreiber muss alle technischen Unterlagen zum Autoklaven und seiner Betriebsmittelversorgung bereitstellen, z. B. zu Wasserqualität, Dampferzeugung, Leitfähigkeit.
- Herstellerinformationen: Anweisungen der Hersteller von Sterilisator, Verpackungsmaterial und Medizinprodukten müssen berücksichtigt werden.
- Verträglichkeitsnachweise: Es muss belegt werden, dass Sterilisiergut und Verpackung den Sterilisationsprozess unbeschadet überstehen.
- Beladungsschemata und Packlisten: Diese zeigen, wie Instrumente, Siebe oder Container im Autoklaven angeordnet werden.
- Kalibrierzertifikate: Alle Messgeräte (für Temperatur, Druck usw.) müssen kalibriert sein – die Nachweise sind vorzulegen.
- Nachweis der Mitarbeiterschulung: Das beteiligte Personal muss entsprechend qualifiziert und geschult sein.
- Installations- und Aufstellungsprotokoll: Dokumentation der ordnungsgemäßen Installation und Aufstellung des Autoklaven durch autorisiertes Fachpersonal.
- Letztes Wartungsprotokoll: Nachweis über die zuletzt durchgeführte Wartung gemäß den Herstellerangaben.
- Vorliegende Validierungsberichte: Sofern bereits Validierungen durchgeführt wurden, sind die zugehörigen Berichte vollständig bereitzustellen.
- Hygieneplan: Es wird überprüft, ob ein aktueller, ausgefüllter und praxisbezogener Hygieneplan vorliegt.
- Sicherheitsdatenblätter der Aufbereitungschemikalien: Bereitstellung der relevanten Sicherheitsdatenblätter zu sämtlichen in der Praxis eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
- Standardarbeitsanweisungen (SOPs): Vorhandensein schriftlicher, praxiseigener Arbeitsanweisungen zu sämtlichen Aufbereitungsprozessen.
- Risikoeinstufung der Instrumente: Dokumentierte Einstufung der in der Praxis eingesetzten Instrumente nach Risikoklassen zur Festlegung geeigneter Aufbereitungsverfahren.
Wie lange dauert eine Validierung?
Je nach Gerätetyp, Beladung und technischer Ausstattung liegt der Zeitaufwand für die Vor-Ort-Durchführung typischerweise zwischen 2 und 5 Stunden.
Die Dauer einer Autoklav-Validierung hängt davon ab, ob es sich um eine Erstvalidierung oder eine Revalidierung handelt. Bei der Erstvalidierung ist der Aufwand höher, da die Leistungsqualifikation in der Regel dreimal durchgeführt werden muss. Ziel ist es, die Reproduzierbarkeit des Sterilisationsprozesses unter identischen Bedingungen nachzuweisen.
Bei einer Re-Validierung genügt in der Regel ein Durchlauf der Leistungsqualifikation, sofern keine Auffälligkeiten auftreten und der Prozess unverändert geblieben ist.
FAQ
Muss ein Autoklav nach der Reparatur validiert werden?
Ja, nach einer Autoklav-Reparatur muss das Gerät validiert werden, wenn die durchgeführte Maßnahme potenziell Einfluss auf die Prozesssicherheit oder -ergebnisse hat. Die Entscheidung darüber trifft der verantwortliche Servicemitarbeiter.